Bei 14 Stunden Zugfahrt wird der Blick ins Grüne irgendwann unerträglich. Gut, wenn man sich mit etwas Lesestoff ausgestattet und vorher Filme oder Podcasts heruntergeladen hat.
Bei den Filmen hatte ich immer noch eine teilweise in New York spielende Geschichte offen, die Baz Luhrmann-Verfilmung von F. Scott Fitzgeralds Roman „The Great Gatsby“. Der Roman, den ich in der Schule gelesen und nie so richtig verstanden habe, erzählt eine unglückliche Liebesgeschichte von dem Selfmade-Man Gatsby und Daisy, die mit Tom Buchanan verheiratet ist, einem Ex-Football-Spieler aus reichem Elternhaus, der seine eigenen Affären pflegt. Vielmehr als um das Beziehungsdrama geht es in der Geschichte aber um neuen und alten Reichtum, Long Island und New York, das Jazz- oder Golden Age und Prohibition. Luhrmann und die Schauspieler Leonardo DiCaprio und Carey Mulligan bringen Ennui und Überfluss gekonnt auf die Leinwand – mögen muss man aber keinen der Charaktere. Trotzdem ein sehenswerter Film mit NY-Aufnahmen z.B. von der Queensborough Bridge.
Die zweite Geschichte, die mich über die lange Bahnreise begleitet hat, diesmal in Buchform, hat besser zu unserer Südstaaten-Tour und dem sumpfigen Grün vor dem Zugfenster gepasst. In dem Roman „James“ von Percival Everett kommt vieles vor, was ich hier in den vergangenen Beiträgen aufgegriffen habe: der Mississippi, Sklaverei, beginnender Bürgerkrieg, sogar die „Underground Railroad“ wird erwähnt.
Der Roman erzählt dabei eine bekannte Geschichte, nämlich Mark Twains „The Adventures of Huckleberry Finn“, allerdings aus der Perspektive des Sklaven Jim. Wie in der Vorlage sind Huck Finn und Jim mit einem Floß auf dem Mississippi unterwegs, der eine, weil er er seinem gewalttätigen Vater entkommen will, der andere weil er auf der von seinem Eigentümer flieht, der ihn von seiner Familie trennen und nach New Orleans verkaufen will. Teilweise gemeinsam, aber immer wieder auch getrennt schlagen sie sich durch. Jim muss dabei ständig um sein Leben fürchten; als geflohener und des Mordes verdächtiger Sklave kann er jederzeit erkannt und mit Folter und Tod bestraft werden. Mit Verstellungen, Verkleidungen, durch Weglaufen entkommt er immer wieder dem drohenden Schicksal und entlarvt für den Leser die Grausamkeiten der Weißen als das was sie sind.
Everett schreibt mit Witz und Ironie. Die primitive und unterwürfige „Sklaven-Sprache“ verwenden die Schwarzen nur, wenn sie mit Weißen sprechen – weil die nichts anderes erwarten; untereinander drücken sich die Sklaven gewählt aus und tauschen Botschaften und Erfahrungen, die die Weißen gar nicht verstehen könnten.
Sollte man gelesen haben! Und ich muss jetzt auch noch mal Mark Twain lesen (hier zumindest Schullektüre).
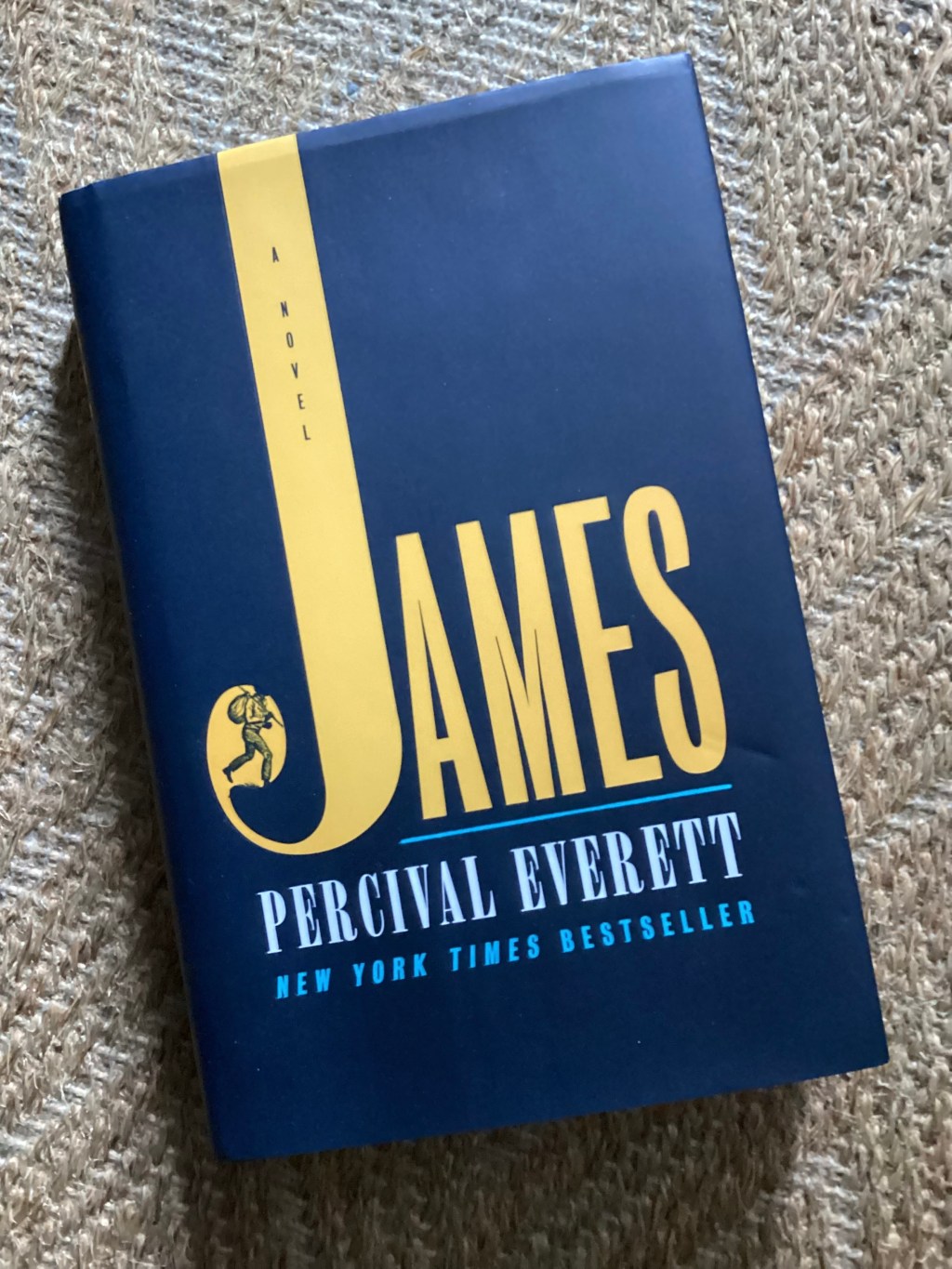
Hinterlasse einen Kommentar